
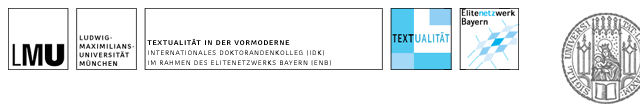
Zwischen Heilsgeschichte und säkularer Jurisprudenz. Politische Theologie in den Trauerspielen des Andreas Gryphius
In seinen Trauerspielen Leo Armenius, Catharina von Georgien, Carolus Stuardus und Æmilius Paulus Papinianus nimmt sich der schlesische Dichterjurist Andreas Gryphius (1616–1664) historische Figuren im Zentrum tödlicher politischer Kontroversen zum Thema und entfaltet diese Kontroversen ambivalent in der Doppelung der beiden Ebenen von Handlung und Figurenrede. Dem scheinbar entschlossenen, bis zum Äußersten gehenden Handeln der Figuren steht deren Unsicherheit oder gar Unfähigkeit gegenüber, dieses ihr obrigkeitliches bzw. aufständisches Handeln auch gut zu legitimieren. Keiner der Handelnden verfügt mehr über ein konsistentes Argumentenarsenal einheitlicher Systematik, sie alle sind konfrontiert mit begründungstheoretischen Leerstellen, stoßen auf Aporien, in denen zwischen lex divina und politischer Dringlichkeit nicht mehr vermittelt werden kann. Das Gebot der Ewigkeit reicht offenbar nicht mehr hin für das Gebot der Stunde. Der Gesetzestext verliert seinen normativen Halt, sobald an seiner legitimationstheoretischen Basis gerührt wird: Gryphius verhandelt in seinen politischen Trauerspielen die Krise traditioneller Naturrechtslehren, die Konkurrenz gängiger politischer Theologien und sich emanzipierender Staatsräson.
Während die Gryphiusforschung die Trauerspiele bislang entweder unter heilsgeschichtlicher oder rechtsphilosophiegeschichtlicher Perspektive beleuchtete, macht sich das Dissertationsprojekt eine Zusammenführung der beiden Blickwinkel zur Aufgabe. Denn wie überhaupt in diesem Stadium der Frühaufklärung, ist hier das Verhältnis theologischer und philosophischer Implikationen – zumal in Fragen des Rechts – nicht in der Weise eindeutig, wie es die heutigen Begriffe von Theologie und Philosophie, gar von Politik, prima vista vermuten lassen. Scheinen theologische und philosophische Argumente einmal in einem Verhältnis von Deutungskonkurrenz aufeinander zu prallen, so scheinen sie dementgegen anderorts in einem Verhältnis von Deutungskonsequenz regelrecht aufeinander zu folgen. In fundamentalen Begründungsstrukturen jedoch scheinen bei genauerem Hinsehen weder die Rede von der Konkurrenz noch von der Konsequenz, auch nicht etwa der Reziprozität, sachlich zutreffen zu wollen. Sie setzen eine grundsätzliche Differenz theologischer und philosophischer Argumente und Denkstile schließlich immer schon voraus. Andreas Gryphius steht mit seinen politischen Trauerspielen weder deutlich vor, noch bereits deutlich hinter der ›Epochenschwelle‹ der Geschichte des säkularen Naturrechts. Vielmehr scheint das Politische in seinen Tragödien von einem komplexen real-, ideen- und rezeptionsgeschichtlichen Zusammenhang abhängig zu sein, in denen gleichermaßen theologische und philosophische Kontexte wirkmächtig sind. Diese Kontexte und ihre Wahrnehmung, ihre Darstellung und Problematisierung durch Gryphius aufzuzeigen, ist Aufgabe der Dissertation.
Figur und Figuration. Eine narratologische Analyse der Vita Seuses
Wer bleibt zurück, wenn das Buch zugeschlagen ist? An wen erinnern wir uns, wenn die Lektüre beendet ist? An die erst unbeschwerte, zuletzt todkranke Effi Briest. Auch im entsubjektivierten Schreiben wie in Jungfrau von Thomas Meinecke wird man kaum jeden Diskurs aus dem Gedächtnis abrufen können, wohl aber die Figur Lothar Lothars als Diskursdurchlauferhitzer. Selbst aus Briefromanen wie Laclos´ Gefährliche Liebschaften bleibt weniger der den Figuren zugeordnete, subtil herausgearbeitete Individualstil zurück, sondern vielmehr der vermeintlich wohl kalkulierende Valmont und die ihn domptierende Merteuil. Literarische Figuren bieten besonders gute Anschlussmöglichkeiten, um sie zu erinnern, sich mit ihnen zu identifizieren, den Fiktionalitätsvertrag willig, ja begeistert mit ihnen per Handschlag zu besiegeln. Wie sieht es nun aber in Texten aus, die nicht darauf angelegt sind, fiktionale Spielräume zu eröffnen, sondern, geradezu diametral dazu, auf religiöse Vervollkommnung zielen, d.h. Texte, die die Sprache dazu nutzen, sich der Wahrheit, letztlich Gott anzunähern? Auch im Bereich religiöser Literatur finden sich Texte, die in der Auseinandersetzung mit diesen grundlegenden Fragen (und Paradoxien) auf das Potenzial der Figuren als Erinnerungs- und Identifikationsspeicher zurückgreifen. Narrativ werden abstrakte Begriffe entfaltet und können über die Figurenlektüre in die Praktiken der Klosterkultur eingebunden werden, so z.B. in Legenden und Viten. Im vorliegenden Dissertationsprojekt möchte ich das Potenzial der Figur des Dieners der ewigen Weisheit aus der Vita Heinrich Seuses betrachten, das nicht darin besteht, ein individuelles Figurenpsychogramm bereit zu stellen, sondern eher als Script beschrieben werden kann. Die Figur lebt einen exemplarischen religiösen Weg vor, wobei unentwegt ihre Konstruiertheit ausgestellt wird, ihre Differenz zur Wahrheit als Bild. Der Rezipientin – selbst eine Figur im Text – wird diese Differenz sorgfältig auseinandergesetzt, um ein Modell zur Heilsgewinnung bereit zu stellen- und um es gleichzeitig zu problematisieren. Die Figuren sind dabei selbst Teil medialer Praktiken, die sich nicht nur sprachlich, sondern auch in einem Bildprogramm niederschlagen. Figurenkonzepte, die anhand fiktionaler, rein sprachlicher Texte entwickelt wurden, greifen für diese komplexe Konstellation zu kurz. Ziel ist deshalb, Funktionsweisen und Strategien der Figurendarstellung in der Vita in Text und Bild nachzugehen und daraus Grundzüge einer Figurenkonzeption mittelalterlicher religiöser Texte zu entwickeln.
Georg Greflinger und das weltliche Lied im 17. Jahrhundert
Im Anschluss an neuere Forschungsbeiträge aus Musik- und Literaturwissenschaft zum Barocklied (Werner Braun, Hermann Danuser, Bernhard Jahn, Irmgard Scheitler) sollen zentrale Paradigmen der Frühneuzeitforschung aufgegriffen und an einem überschaubaren, jedoch durch sein Facettenreichtum repräsentativen Kernkorpus, nämlich den Liedersammlungen Georg Greflingers (1620-1676), im Kontext zeitgenössischer musiktheoretischer und poetologischer Diskurse sowie kulturgeschichtlicher Aspekte verhandelt werden. Die in diesem Zusammenhang entstehende biographie intellectuelle Georg Greflingers – eines bisher unterschätzten Autors, den es als herausragenden Vertreter der barocken Lieddichtung zu entdecken gilt – stellt dabei eine zusätzliche Aufgabe des Projekts dar.
Es handelt sich um eine Arbeit, deren Gegenstand durch einen dezidiert interdisziplinären Ansatz adäquat erfasst wird. Im Mittelpunkt steht die Analyse von „Wort“-Texten und Musikalien, denn die Lyrik der Frühen Neuzeit war viel stärker, als dies bislang von der Forschung reflektiert wurde, auf Vertonung angelegt. Eine angemessene Untersuchung ist also nur möglich, wenn die doppelte Textualität des Kunstprodukts „Lied“ beachtet wird. Das Aufgreifen sowohl musik- als auch literaturwissenschaftlicher Methoden und Fragestellungen ist somit konstitutiv für das Projekt. Schwierigkeiten und mögliche Grenzen des interdisziplinären Ansatzes, die sich hierbei beispielsweise in der Terminologie ergeben, sollen dabei nicht umschifft, sondern überprüft und ausgehandelt werden.
The Polyphony of the Old English Soliloquies
My doctoral research concentrates on the specific case of the Old English Soliloquies, a remarkably free translation of Augustine's Soliloquia in the Anglo-Saxon vernacular. This Anglo-Saxon text has posed many problems for scholars and editors in the past: the full text survives in one of the latest Old English manuscripts from the mid-twelfth century only, BL Cotton Vitellius A. xv, while the lost original translation has been placed in the context of King Alfred's court in the ninth century. In short, the sole witness to one of the earliest Old English prose records comes down to us from the mid-twelfth century, that is, from a time when the Old English language became already obsolete and the Anglo-Saxon period is commonly considered to be over. Besides this single late copy, only two short excerpts in an eleventh century manuscript (BL, Cotton Tiberius A. iii) testify to a foregoing tradition of the text - other than that, nothing is left. With this history in mind, it is thus not surprising that the Soliloquies, as we find them in the twelfth-century Vitellius copy, are far from forming a consistent and coherent piece. In fact, the text reveals plenty of gaps and fissures, ambiguities and fusions in terms of content, form and language.
How to approach such a diverse and difficult text? So far, scholars unanimously ignored the transmission history of the Soliloquies and confidently read the text through the prism of its origin, the mythical author-figure King Alfred. An awareness of the incongruity between this standard interpretive frame and the material reality of the text shows in no more than occasional mentions of the "limited" and "corrupt" state of the manuscript. Editors fared with more timidity in undoing the chronological gap of more than 200 years between lost original and copy in hand. Except for early transcriptions, all editions try to strike a balance between emendation and preservation. Although there have been several such attempts - the Soliloquies curiously enough rank among the most frequently edited of Old English prose texts -, no edition has yet been regarded as satisfying.
The aim of my work is to develop a fresh approach to the Old English Soliloquies that takes into account the premodern condition of the text and the dynamics it is exposed to during the transmission process. In order to capture the multilayered fabric of the Soliloquies, a reading model will be applied that allows for the intervention of contributors other than the author alone: scribes, adapters, compilers may have laid their hands on the text as it passed them by; they may have modified the text on the level of dialect and wording or through more substantial rewriting, omission, replacement or rearrangement of whole sections of the work. The result will not be an interpretation that anchors the text in one author and context only, but a collection of vignettes that span the centuries of the text's making and investigate it from different directions and perspectives.
The ambition to acknowledge the Soliloquies in the way they are presented in the manuscripts is certainly closely linked to the current scholarly desire to ground research on medieval literature in the actual manuscripts and their variants rather than in editions which reduce pluralistic text forms to one authoritative version and in doing so, erode the cultural difference so characteristic of medieval textual culture. However, as reading the Soliloquies in the performance context of each manuscript only would be an equally unilateral perspective as the traditional insistence on the text's origin, this work shall coalesce the achievements of the Old Philology with the New Philological call for the recognition of the medieval text's fluidity and flexibility in order to render audible the many voices inscribed into the Old English Soliloquies.
Gattungsgeschichte des deutschen Komplimentierbuchs
Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert erschienen etwa 40 Werke in bis zu 26 Auflagen, die Komplimentierbuch betitelt sind und mehr als 60 weitere, die entweder einen Hinweis aufs Komplimentieren im Titel tragen oder von der Forschung als Komplimentierbuch eingestuft werden. Diese sich offenbar gut verkaufenden Werke behandeln neben allgemeinen Fragen des Anstands vor allem das Komplimentieren, indem sie rein theoretisch, theoretisch mit Beispielen unterstützt oder rein exemplarisch Komplimentieranleitungen geben. Der zeitgenössische Leser sollte befähigt werden, seine Glückwünsche, Bitten, Grüße oder Kondolenzen in einer der aktuellen gesellschaftlichen Norm angepassten Form vorzubringen.
Bis heute ist, trotz umfangreicher und entscheidender Forschung vor allem von Manfred Beetz, die Gattung des Komplimentierbuchs weder in ihrem Umfang noch in ihrer Gattungsgeschichte eindeutig bestimmt.
Anhand der zeitgenössischen Gattungsauffassung soll im Rahmen meines Dissertationsprojekts zunächst ein Textkorpus erstellt werden. Dabei wird vorerst die Gattungsbenennung im Paratext, vor allem im Titel, entscheidend sein, ferner sollen Poetiken berücksichtigt werden. Das vorwiegend induktive Vorgehen wird erweitert durch eine Neuinterpretation des Textkorpus‘ und daran anschließende Ausschlüsse und Neuaufnahmen. Mit diesem rezeptionsästhetisch-konstruktivistischem Vorgehen soll eine Definition und eine Bibliographie des Komplimentierbuchs erarbeitet sowie die Gattungsgeschichte beschrieben werden.
Bei der gattungsgeschichtlichen Erforschung werden zwei Aspekte von besonderer Bedeutung sein. Zum einen verweisen Komplimentierbücher auf die Kommunikationswirklichkeit, indem sie Anleitungen geben, die der Leser umsetzen soll. Zugleich zielen sie darauf, auf die Kommunikationswirklichkeit einzuwirken und reagieren daher notwendigerweise auf diese. Das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit wird zu prüfen sein. Zum anderen reflektieren die Komplimentierbücher über den Bezugspunkt der Kommunikationsrealität die Gesellschaft und ihre Struktur, da die Art der Komplimente vom sozialen Stand der Aktanten abhängt. Dadurch bietet diese Gattung Ansatzpunkte für sozialgeschichtliche Überlegungen, darunter der, inwiefern sich sozialstrukturelle und gesellschaftliche Veränderungen im Umgang und in Anstandsliteratur niederschlagen.
Die "englische Art zu reden". Untersuchungen zu mystisch-spiritualistischen Texten in den postreformatorischen Kreisen des 17. Jahrhunderts
Meine Dissertation versucht, durch konkrete Textbeispiele zum einen die spiritualistischen Bewegungen in Schlesien in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu präsentieren und zum anderen einen Beitrag zur Frömmigkeitsgeschichte und Traditionsbildung in einem in geographischer und sozialgeschichtlicher Hinsicht disparaten Umfeld zu leisten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den immer wieder gewagten Versuchen, das Unsagbare zum Thema der Kommunikation zu machen. Im Zentrum stehen Texte aus dem Umfeld der Straßburger Gottesfreunde, in erster Linie die Sermones, die unter dem Namen Taulers zum Druck befördert wurden, und Texte von schlesischen Spiritualisten, zum Beispiel von Johann Theodor von Tschesch (1595-1649).
Folgende Fragen zielen auf den Status der Texte, ihre Funktionsweise und ihre Geltungsansprüche in ihrem spezifisch historisch-kulturellen Umfeld:
1. Wie funktioniert Frömmigkeit und Traditionsbildung neben der Theologie im Katholizismus und in den protestantischen Bewegungen?
2. Das "Ringen" um die Sprache: Wie wird versucht, das Sprechen über Gott und das Göttliche in Worte zu fassen? Wie läßt sich die mystisch-spiritualistische Rede hermeneutisch beschreiben?
3. Wie und wo wirken mystisch-spiritualistische Texte? Dem historisch-kulturgeschichtlichen Umfeld kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden und verbreiteten sich spiritualistische und auch schwärmerische Schriften vor allem in vorpietistischen Kreisen, die in der Regel ein geschlossenes Publikum darstellten.
4. Wie rechtfertigt der Autor Johann Theodor von Tschesch sein Schaffen in einer Zeit von religiösem Zerfall und Verworrenheit als "wahre Lehre"? Wie funktioniert spirituelle Kommunikation einerseits als individuelles Erlebnis in der Schrift, andererseits als Erlebnis in einer von mündlicher Kommunikation geprägten geschlossenen Gemeinschaft und drittens vor einer breiten Öffentlichkeit im Buchdruck? Wie werden spirituelle Texte, die in Einsamkeit entwickelt und formuliert werden, wieder an die gemeinschaftliche Kommunikation angeschlossen?
Auf der Basis detaillierter Betrachtung von Textbeispielen werden die mystisch-spiritualistischen Denk- und Kommunikationsstrukturen vorgestellt und analysiert. Dabei wird auch untersucht, wie Spiritualität in unterschiedlichen Medien dargestellt und erlebbar gemacht wird und welche Rolle folglich bei dieser Art des Sprechens der Mündlichkeit, der Schriftlichkeit und dem Buchdruck zukommt.
Die Poetik der Intertextualität in den Gawan-Büchern von Wolframs von Eschenbach ‚Parzival’
Mein Dissertationsprojekt setzt sich mit der besonderen poetischen Machart von Wolframs Erzählweise auseinander. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf den Gawan-Büchern des ‚Parzival’, wobei die zweite Gawan-Partie im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Die dem counterpart des Romanhelden gewidmeten Teile verdienen – gerade auch im Hinblick auf die Andersartigkeit ihrer Komposition im Vergleich zu den Parzival-Partien – besondere Aufmerksamkeit. Lachmanns Bucheinteilung ist in dieser Hinsicht schon häufig kritisiert worden. Bei den Büchern X – XIV, die inhaltlich eng miteinander verwoben sind, ist sie besonders problematisch. Es gilt daher die poetologische Struktur dieses Romanabschnitts herauszuarbeiten und der Frage nachzugehen, welchen inneren Ordnungsprinzipien er unterliegt.
In diesem Zusammenhang sollen die zahlreichen in den Gawan-Büchern enthaltenen inter- und intratextuellen Bezüge nicht allein auf ihre Funktion bei der Charakterisierung von Ereignissen und Figuren der Handlung hin untersucht werden, sondern vor allem auch in ihrer Relevanz für die poetische Gestalt dieser Textpartien. Die Umgestaltung der Chrestienschen Vorlage soll ebenfalls eingehend betrachtet werden. Wo, so ist zu fragen, löst die spezifische Beschaffenheit der Vorlage beim Nachdichter reaktive Prozesse, d.h. Reflexion, Ausdeutung, Verwerfung, Umdeutung, beredtes Schweigen, Ironisierung aus? Es wird auch zu prüfen sein, wie sich das Abbrechen der Vorlage auf Wolframs Art zu erzählen auswirkt.
Strategien der Textproduktion. Die Passionen des Benedictus Chelidonius
Aus der Feder des Nürnberger Mönches Benedictus Chelidonius (Anfang 16. Jh.) liegen zwei in Machart und Form völlig verschiedene Texte zum Thema der Passion Christi vor. Bekanntheitsgrad erhielten sie besonders durch die Veröffentlichung mit den Holzschnittpassionen Albrecht Dürers, der Großen und der Kleinen Passion.
Für den Text der Großen Passion in Hexametern (a. 1511) kompilierte Chelidonius Passagen aus vier weiteren biblischen Epen, etwa aus dem ‚Klassiker' der Spätantike, Sedulius, und dem ‚zweiten Vergil' des Humanismus, Baptista Mantuanus. In margine sind dabei jeweils die Kürzel der Referenzautoren angegeben, wodurch dem Leser ermöglicht wird, nicht nur den vorliegenden Text, sondern auch dessen Referenz- oder Prätexte wahrzunehmen.
Den ersten Teil der Dissertation nimmt nun die Beantwortung folgender Fragen ein: Welche Strategien verfolgt der Dichter und Kompilator bei dieser Art intertextueller Textproduktion? Welche Auswahlkriterien legt er an den Referenztexten an und welche Konsequenzen hat sein selegierendes Verfahren für eine innovative inhaltliche und formelle Umsetzung der bekannten biblischen Thematik? Welche Textoperationen und -transformationen sind nötig, in der auf diese Weise entstandenen Cento-Dichtung (griech. ‚Flickwerk') Kohärenz zu gewährleisten? Welche Funktionalität lässt eine derartige Textverarbeitung erkennen?
Folgt man der Einteilung der Intertextualitätsdebatte in Einzeltext- und Systemreferenz, ist es unumgänglich, den Text der Großen Passion nicht nur in seinen Bezug zu den Systemtexten ‚Bibelepik' und ‚Andachtsliteratur', sondern auch zum Systemtext ‚Traktat- und Predigtliteratur' zu stellen, zumal die in margine-Markierung der Referenztextwechsel auf Konventionen der Bibelkommentierung der Zeit verweist.
Die Kleine Passion, bestehend aus 36 meist 20-zeiligen Gedichten (Erstdruck mit Wechtlin-Holzschnitten, a. 1508), gibt im Titel der einzelnen Gedichte akribisch das jeweils verwendete Versmaß an, was die Vermutung nahe legt, dass Chelidonius seine Gedichte im Kontext der zeitgenössischen Poetik lokalisiert wissen möchte. Die Tatsache, dass vor allem Odenversmaße des Horaz verarbeitet sind, eröffnet mehrere Wege einer Annäherung an Funktionalität und Anspruch der Kleinen Passion: Conrad Celtis etwa beschreibt den Großteil der von Chelidonius verwendeten Metren in seiner Ars versificandi von 1486, nach seiner Dichterkrönung 1487 tritt er immer wieder mit Oden auf, die gesammelt postum (a. 1513) herausgegeben werden. Philomusus Locher besorgt 1501 eine Horazausgabe, in deren Einführung die verschiedenen metrischen Formen vorgeführt werden. Schließlich vertont Petrus Tritonius 1507 eine Auswahl der Odenmetren in den Melopoiae sive Harmoniae tetracenticae super xxii genera carminum Heroicorum Elegiacorum Lyricorum & ecclesiasticorum hymnorum [...] ductu Chunradi | Celtis. Der einleitenden Übersicht über die Versmaße sind sowohl Beispiele aus den Horaz-Oden als auch aus den Celtis-Oden beigegeben. Im Rahmen dieser Veröffentlichung verfasst Chelidonius ein Lobgedicht auf Celtis und zeigt sich damit dem Kreis der süddeutschen Humanisten zugehörig.
Die Texte der Kleinen Passion sind folglich im Kontext antiker wie humanistischer Dichtungslehre und Dichtung zu lesen. Zweifelsohne soll die Passion erbauen, sie zieht inhaltlich alle entsprechenden Register (z.B. Hymne auf das Schweißtuch, Aufruf zur unio mystica, Marienklage), doch geschieht dies unter dem Anspruch hochartifizieller Dichtkunst. Somit findet nicht nur die gelehrte Literaturproduktion aus dem Umfeld des Chelidonius im zweiten Teil der Dissertation Beachtung; auch die direkten intertextuellen Referenzen, besonders auf Horaz und Celtis, und die besondere Machart und Funktionalität der Gedichte der Kleinen Passion bilden einen Schwerpunkt der Untersuchung.
Exkurshaft wird abschließend das Text-Bild-Verhältnis der Erstpublikationen von 1508 und 1511 diskutiert; die möglichen Beurteilungen des Bildmediums als Illustration bzw. des Textmediums als ‚Bildbeschreibung/Bildgedicht' greifen zu kurz und bedürfen einer neuen Gewichtung.
kein dinc so wilde wunderhaft - Spielräume mittelhochdeutscher Mariendichtung des Spätmittelalters. Konrad von Würzburg: Die Goldene Schmiede
Mittelalterliche Dichtung bewegt sich beständig in einem Spielraum zwischen Stofftradition und Retextualisierung. Nicht Originalität eines Stoffes wird verlangt, sondern seine kunstvolle, angemessene Präsentation. Für die Epik hat Franz Josef Worstbrock dafür den Begriff des „Wiedererzählens“ geprägt. Für einen vergleichbaren Prozess bei der Produktion nicht-narrativer Texte hat sich noch kein konsensfähiges Konzept durchgesetzt.
Im Hoch- und Spätmittelalter entstehen im deutschen Sprachraum zahlreiche Mariendichtungen in der Volkssprache. Während in den Marienleben die Geschichte der Gottesmutter meist chronologisch erzählt wird, stehen in den nicht-narrativen („lyrischen“) Texten andere Sprechakte im Vordergrund. Beiden Textgruppen gemeinsam ist die Auseinandersetzung mit den Paradoxien um die Gottesmutter Maria (Präexistenz, Verkündigung, jungfräuliche Geburt, u.a.).
In meiner Dissertation vergleiche ich nicht-narrative Mariendichtungen des Spätmittelalters mit epischen Marienleben im Hinblick auf ihren jeweiligen Umgang mit diesen Paradoxien. Ich frage, auf welche Diskurs- und Gattungstraditionen die Verfasser zurückgreifen, welche Spielräume zur Neugestaltung sie nutzen und wie sie den Prozess der Retextualisierung reflektieren. Der Umgang je spezifische Wahrheitsanspruch dieser Texte muss in die Untersuchung mit einbezogen werden.
Die „Goldene Schmiede“ Konrads von Würzburg, ein etwa 2000 Verse umfassendes Marienlob aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, bildet aus mehreren Gründen den Mittelpunkt der Analyse. Erstens ist der Text ein (poetologisch und konzeptionell) herausragendes Beispiel für den Versuch, die Paradoxien der Heilsgeschichte mit poetischen Mitteln zu bewältigen. Zweitens wird die Paradoxie der Darstellung des Nichtdarstellbaren auf hohem Niveau reflektiert. Drittens war der Text sehr erfolgreich und hat eine weite Verbreitung erfahren. Das Besondere daran ist, dass er in verschiedenen Kontexten – städtischen und monastischen – überliefert wurde. Die jeweiligen Redaktionen der „Goldenen Schmiede“ lassen verschiedene Interessen erkennen. Dies hat zum Teil starke Spuren im Text hinterlassen. Neben den Versfassungen ist in zwei Handschriften eine Prosafassung überliefert; mindestens drei stark voneinander abweichende Schlüsse des Textes sind überliefert. Daneben weisen bestimmte Handschriften vor allem am Beginn und Ende sowie an einigen Schlüsselstellen Besonderheiten auf. An der „Goldenen Schmiede“ können daher zwei verschiedene Retextualisierungsprozesse untersucht werden: zum einen der Umgang Konrads von Würzburg mit den Stoff- und Gattungstraditionen der Mariendichtung und zum anderen die Transformationen des Textes im Prozess seiner Überlieferung.
Das Ziel meines Dissertationsprojektes ist die Analyse spezieller Figuren und Handlungskonstellationen mit Hilfe von kriegerischen Symbolen wie Waffen, Rüstungsgegenständen und Bannern hinsichtlich ihrer ‚Kohärenz’ und ihrer spezifischen ‚Identität’. Dabei wird keineswegs die Formulierung allgemeingültiger Aussagen über den Identitätsbegriff der höfischen Gesellschaft angestrebt, weder aus real-historischer Perspektive noch unter fiktiv-literarischen Gesichtspunkten. Vielmehr liegt mein Hauptaugenmerk auf der Singularität und Unverwechselbarkeit einzelner Figuren, die durch den narrativen Einsatz ganz unterschiedlich funktionalisierter kriegerischer Attribute konstruiert wird. Den Ausgangspunkt meiner Untersuchung bilden dabei Schlüsselfiguren aus dem „Parzival“ und dem „Willehalm“, den beiden epischen Hauptwerken Wolframs von Eschenbach. Sowohl altfranzösische Prätexte wie Chrétiens „Perceval“ als auch parallele Texte der höfischen Epik wie Heinrichs von Veldeke „Eneasroman“ oder Gottfrieds von Straßburg „Tristan“ werden vergleichend herangezogen.
Zwei Fragestellungen stehen im Vordergrund: Erstens gilt es systematisch das Spektrum zu erschließen, in dem Waffen und Rüstungen zur Stiftung narrativer Kohärenz verwendet werden können. Das Verhältnis zwischen Kampftauglichkeit und repräsentativer Schönheit der kriegerischen Ausstattung, die An- oder Abwesenheit bestimmter Dingsymbole in speziellen Situationen und besonders die Übereinstimmung oder auch Nichtübereinstimmung zwischen Zeichen und Träger sind zentrale narrative Mittel, die komplexe Zusammenhänge sowohl auf der Figuren- als auch auf der Handlungsebene begreifbar machen können.
Textualität und Dichtungstheorie in den Epigrammen Martials: Strategien literarischer Selbstbespiegelung
Das Werk des antiken Epigrammdichters Marcus Valerius Martialis (ca. 38/41 n. Chr. – ca. 104 n. Chr.) stellt innerhalb der uns überlieferten Epigrammdichtung aus dem Altertum eine Besonderheit dar: Anders als im Fall der uns in der Anthologia Graeca und Anthologia Latina erhaltenen Epigramme, deren ursprünglicher Sitz in Gedichtbüchern nur mehr erahnt und teilweise mit mühevollem philologischem Fleiß rekonstruiert werden kann, besitzen wir mit dem Œuvre Martials fünfzehn im Großen und Ganzen vollständige Epigrammbücher. Es handelt sich um den Liber Spectaculorum, die Xenia und Apophoreta, und das corpus der – vom Autor selbst nummerierten - XII Epigrammaton libri, wobei man von Publikationsdaten all dieser Bücher im Zeitraum der Jahre zwischen 80 und 102 n.Chr. ausgeht.
Innerhalb der thematisch vielfältigen, sich vor allem mit Aspekten des römischen Alltagslebens auseinandersetzenden Epigramme, existiert eine beträchtliche Zahl von metapoetischen Gedichten, in denen die sich durch das Werk hindurch inszenierende Sprecher-persona unterschiedliche Reflexionen über produktions- und rezeptionsbezogene Sachverhalte der Dichtung anstellt. Dazu gehören sowohl im innerfiktionalen als auch - vorgeblich - außerfiktionalen Diskurs (in den Prosavorreden zu einzelnen Epigrammbüchern) Aussagen zum Charakter der eigenen Dichtung, zum Verhältnis zu Dichterkollegen, Kritikern und Patronen, zu den mit der Komposition und Publikation von Gedichtbüchern verbundenen Problemen, zur Rolle des Lesers bzw. des bei Rezitationen anwesenden Publikums und zu vielen anderen Aspekten des zeitgenössischen Literaturbetriebs. In der Forschung hat man sich bisher mit Einzelaspekten der metaliterarischen Reflexionen in Martials Dichtung befasst, doch es fehlt eine systematische Gesamtdarstellung, die aufbauend auf einem theoretischen Fundament das Phänomen der Metapoetik in Martials Epigrammpoesie untersucht. In meinem Dissertationsprojekt versuche ich daher, auch mit Hilfe der Erkenntnisse moderner Forschung zum Thema Metaliteratur, Martials Strategien literarischer Selbstbespiegelung zu untersuchen.
Ich gehe von der These aus, dass Martials Epigramme, so wie sie uns vorliegen, für eine Publikation in Buchform für ein breiteres Lesepublikum intendiert waren (dies legen schon die häufigen Reflexionen des Dichters über das Medium Buch nahe), freilich nicht ohne auch die Möglichkeit anderer Formen der Verbreitung innerhalb eines kleineren, dem historischen Autor nahestehenden Leserkreises (Freunde, Patrone, Gönner) in Erwägung zu ziehen. Die Implikationen des Buchkontextes für die Rezeption einzelner Epigramme stellen den Gegenstand jüngerer Studien zur griechischen und römischen Epigrammatik dar, und auf diesen neuen Erkenntnissen aufbauend soll meine Dissertation nun klären, welchen wirkungsästhetischen Effekt metareflexive Passagen bei der Lektüre einzelner Epigrammbücher Martials auf einen antiken Leser erzielt haben könnten.
Im Zuge einiger theoretischer Überlegungen zum Bereich Metaliteratur werde ich diskutieren, inwieweit sich moderne Konzepte auf einen antiken Text anwenden lassen, bevor ich mich dann mit Martials spezieller Form der Metapoetik vor dem Hintergrund anderer lateinischer und griechischer Texte, in denen poetologische Reflexionen auftauchen, befasse. Bei Martial fällt im Rahmen selbstreflexiver Aussagen besonders das Hervorkehren des Materiellen und Konkreten auf, so etwa bei der Thematisierung des Mediums Buch, das häufig in sehr plastischer Art und Weise als Buchrolle oder teilweise auch als Kodex, verbunden mit der Beschreibung technischer Details, imaginiert wird. Der Hauptteil meiner Arbeit widmet sich den nach thematischen Kriterien unterteilten metaliterarischen Äußerungen Martials, wobei immer der Kontext, in dem solche Epigramme stehen, berücksichtigt werden soll. Dazu gehören einerseits Überlegungen der Dichter-persona zu den Problemen der Textgestaltung – z.B. Komposition und Veröffentlichung des Buches, Umfang und Metrum einzelner Epigramme, das Verhältnis zu anderen Epigrammdichtern bzw. anderen Gattungen – und andererseits zu den Problemen der Textrezeption – z.B. durch den allgemeinen Leser, aber auch spezielle Rezipienten wie Freunde, Patrone, den Kaiser, Kritiker, sowie auch das Assoziieren des Rezeptionsvorganges mit der Teilnahme an außerliterarischen Begebenheiten wie Festen, Triumphen und Schauspielen.
Mit Hilfe einer derartigen umfassenden Studie zu Martials poetologischen Aussagen und Strategien der literarischen Selbstbespiegelung hoffe ich, neue Erkenntnisse zur Textualität und Konzeption seiner Epigrammbücher gewinnen zu können.
Die Schedelsche Weltchronik - Konzeption und Kompilation einer illustrierten Weltgeschichte der frühen Neuzeit
Die 1493 als Gemeinschaftsprojekt Nürnberger Frühhumanisten und Künstler (u. a. Schreyer, Wolgemut, Pleydenwurff, Münzer und wohl auch Celtis) entstandene Schedelsche Weltchronik ist als eine der bedeutendsten drucktechnischen und buchkünstlerischen Leistungen des Inkunabelzeitalters in nahezu alle Details ihrer Entstehung erforscht. Verhältnismäßig geringe Beachtung hat dagegen bisher der lateinische Text gefunden, der von Hartmann Schedel kompiliert wurde. Offensichtlich hat die Tatsache, dass er offen als Kompilation ausgewiesen ist und die zentrale Vorlage mit dem Supplementum chronicarum des Jacopo Foresti (Venedig 1483 ff.) früh identifiziert wurde, die textuelle und konzeptuelle Struktur der Chronik nicht weiter als Forschungsdesiderat ausgewiesen. Die offenkundige Dependenz von Foresti sollte aber nicht den Blick für die Eigenheiten der Schedelschen Kompilationstechnik verstellen, die häufig, teilweise in jedem Satz die Vorlage wechselt und das von Forestis Text gebildete Gerüst mit den ihm verfügbaren Autoritäten seiner Zeit (allen voran Enea Silvio Piccolomini) füllt. Da auch Forestis Konzeption bisher kaum untersucht ist, muss der konzeptuelle Vergleich beider Werke den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden. Der historiographische Ansatz ist bei beiden letztlich in einer auf Personen-Biographien reduzierten sequenzialisierten Geschichtsordnung verankert. Über die nahezu vom Anbeginn der Welt bestehende, kontinuierliche Parallelität von geistiger und weltlicher Herrschaft (Zwei-Schwerter-Theorie) hinaus fungieren dabei einige weitere, zahlenmäßig begrenzte Personenkategorien (z. B. Philosophen, Ärzte) als systematische Leerstellen, deren Füllung Fragen nach der zugrunde liegenden Wissensorganisation und die Nähe zur chronologisch organisierten Enzyklopädie aufscheinen lassen. Bereits bei Foresti kann zudem die Aufnahme von zahlreichen Beschreibungen italienischer Städte und somit eine Ausdehnung des streng chronikalen, heilsgeschichtlich orientierten Gattungsschemas auf geographische und geopolitische Aspekte beobachtet werden. Dieser Ansatz wird in der Schedelschen Weltchronik so weiterverfolgt, dass die zahlreichen großformatigen Stadtillustrationen als wesentliche Gliederungselemente des zeitlichen Kontinuums und zugleich als Strukturelemente der Werkkonzeption erscheinen. Durch sie wird die vertikal aufsteigende Linie der Heilsgeschichte mit einer horizontalen Ebene verschränkt, deren Perspektive auf die umgebende Welt und darin in erster Linie auf die im Entstehen begriffene deutsche Nation gerichtet ist. Der Einfluss zeitgenössischer politischer Diskurse zu Reichsidee und Reichseinheit ist hier ebenso relevant wie das in Analogie zur translatio imperii entwickelte bildungstheoretische Konzept der translatio studiorum. Unter diesen Aspekten soll Schedels Kompilationstechnik mit textgenetischen Analysen charakterisiert werden, die die bei der Einpassung diverser Textgattungen (z. B. historiographische, geographische oder kosmologische Literatur) oder Textsorten (z. B. Briefe, Flugblätter) in das chronikale Schema auftretenden textlinguistischen, gattungsspezifischen oder ideengeschichlichen Transformationsprozesse nachvollziehen.
„Formen des Erzählens im jiddischen Maysebuch“
Das Maysebuch, eine Kompilation von gut 250 lehrhaften Erzählungen, gilt als das Gründungsdokument der jiddischen Schriftliteratur. Erstmals gedruckt in Basel 1602, konstituiert sich hier das schriftliche jiddische Erzählen aus älteren literarischen Traditionen: Einerseits steht das Maysebuch im Kontext der hebräisch-aramäischen Traditionsliteratur der jüdischen Religion, andererseits aber auch im Kontext der deutschsprachigen Literatur, die der jiddischen Literatur sprachlich nahesteht und deren Produzenten und Rezipienten räumlich und kulturell mit den Jiddischsprechenden eng verbunden sind. Aber wie fügt das Maysebuch Elemente dieser Traditionen zusammen und wie bringt es daraus eine neue Art des Erzählens hervor, die die spätere jiddische Literatur nachhaltig beeinflusst?
Das Promotionsprojekt untersucht die Erzählformen im Maysebuch in ihren historischen und literarischen Kontexten. Die Betrachtung des Maysebuchs insbesondere unter erzählformalen und gattungstypologischen Gesichtspunkten gibt Aufschluss über den Prozess der Konstitution der jiddischen Schriftliteratur im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert – und über Aspekte der Beziehungen zwischen Juden und Christen in dieser Zeit. Das Maysebuch zeigt eine bemerkenswerte Mischung von Elementen aus der religiösen hebräisch-aramäischen Literatur einerseits und Erzählstrategien, die im Rahmen dieser Tradition keine Vorbilder haben, andererseits. Letztere werden aus der Literatur der umgebenden christlichen Mehrheitskultur produktiv transferiert.
Dabei ist für das Maysebuch eine im Vergleich zur hebräischen Erzählliteratur größere Autonomie des Erzählens charakteristisch, wobei dieses Erzählen allerdings stets dem Ziel religiöser Unterweisung unterstellt bleibt. Anhand von Analysen exemplarischer Mayses kann diese Entwicklung nachvollziehbar gemacht werden. Im Blick auf die gesamte Kompilation schließlich werden auch über punktuelle Bezüge hinausgehende, systematische Zusammenhänge des jiddischen Maysebuchs mit anderen frühneuzeitlichen Sammlungen deutlich.
Die Textualität frühmittelalterlicher Glossen
Unter frühmittelalterlichen Glossen versteht man i.d.R. sekundäre Eintragungen in lateinische Handschriften, die das Verständnis des Handschriftentextes fördern sollen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht die Germanistik althochdeutsche Glossen, stellt diese allerdings zunächst in den Schatten der prominenteren Textdenkmäler. Ein Paradigmenwechsel der Glossenforschung führte in den letzten Jahren zu einer Neubewertung von Glossen als früheste Zeugnisse der Verschriftung der deutschen Volkssprache, als bedeutende lexikalische Quellen sowie als Ausgangspunkte kulturgeschichtlicher Fragestellungen in Hinblick auf Wissensaneignung, -vermittlung und -speicherung sowie Kanonisierungsprozesse im Frühmittelalter.
Mein Dissertationsprojekt knüpft an dieser Stelle an und wird erstmals eine umfangreichere Studie zu frühmittelalterlichen Glossen aus textlinguistischer Perspektive liefern. Hierbei beziehe ich mich auf kommunikativ-pragmatische Textmodelle der synchronen Textlinguistik, die ‚Text‘ als zentralen Teilaspekt von Kommunikationshandlungen erachten und von einer Determination der sprachlichen Mittel durch die interaktionale Gesamtkonstellation ausgehen. Neben der Historisierung und Adaption auf meinen Untersuchungsgegenstand sind diese top-down-Ansätze allerdings mit philologischen Detailanalysen zu kombinieren, die das Fundament weitergehender funktionaler Fragestellungen bilden müssen. Hermeneutische Wechselbewegungen zwischen Teil und Ganzem werden hierfür folgende drei Dimensionen von Textualität der Glossen erschließen.
Frühmittelalterliche Glossen bilden (1) konventionalisierte Muster der Textbewältigung innerhalb spezifischer historischer (angelsächsische Mission, karolingische Renaissance) und räumlich-situativer Entstehungskontexte (Klosterschule, -bibliothek, private Zelle). Glossen (2) besitzen Textualität auf Grund ihrer semantischen Anbindung an den Handschriftentext, den sie in unterschiedlichsten Ausprägungen ergänzen, erweitern und kommentieren. Schließlich (3) bewirkt die immer gleichartige Strukturierung der von nur einer Person erstellten Glossen (z.B. Positionierung der Glossen, paläographische Eigenheiten) die Kohäsion innerhalb einer Glossierungsschicht.
Unter Rückgriff auf ein heterogenes Korpus von Textglossierungen, das Varianz in Hinblick auf zeitliche, räumliche, situative, sprachliche, funktionelle und formale Faktoren aufweist, werden die jeweils individuellen Ausprägungen sowie die Interdependenzen der drei Dimensionen von Textualität herausgearbeitet und systematisiert. Der Einbezug von Glossaren wird die vielschichtigen Umfunktionalisierungsprozesse beim Übergang der Glossen von sekundären zu primären Bestandteilen einer Handschrift illustrieren, was neben der Thematisierung intertextueller Fragestellungen zu einer Abwendung von starren Autorschaftsmodellen hin zu einem kollaborativen, offenen und dynamischen Textkonzept frühmittelalterlicher Glossen führen wird.
Der stimmliche Vortrag in der antiken Rhetorik. Die vox zwischen der Mündlichkeit der Aufführung und der Schriftlichkeit des Textes
Der Vortrag der Rede (grch. hypokrisis/lat. actio oder pronuntiatio) gilt antiken Rednern und Rhetoren als das Wichtigste in der Rhetorik überhaupt. Er allein entscheidet in der Praxis über Erfolg und Misserfolg. Daher wird der performative Charakter der Rede auch in der Theorie unter korporalem (grch. schemata tou somatos/lat. gestus bzw. sermo corporis) und oralem Aspekt (grch. phone/lat. vox) eingehend behandelt. Während die Körpersprache in der Forschung viel Beachtung fand, wurde die Bedeutung der Stimme des Redners meist außer Acht gelassen. Ziel meiner Dissertation ist es, diese Lücke zu schließen, d.h. die Bedeutung des kunstvollen stimmlichen Vortrags in der antiken Rhetorik aus den überlieferten Texten zu rekonstruieren.
Das zugrunde liegende Textcorpus vereint präskriptive und deskriptive rhetorische Texte. Den größten Anteil nehmen die Vorschriften zur Stimme des Redners ein, die ein Anonymus in der sogenannten Rhetorica ad Herrenium (bislang datiert auf ca. 86-82 v.Chr.) und Quintilian in der Institutio oratoria (um 92 n.Chr.) geben. Hinzu kommen weit verbreitete Beschreibungen rednerischer Performanzleistung, wie wir sie vor allem in Ciceros Brutus, bei Seneca rhetor und den griechischen Rednern finden.
Im Zentrum der Arbeit steht die Kommentierung von Quint. inst. 11,3,14-65 und Rhet. Her. 3,11,19-3,14,25. Die Herausforderung dieser Texte liegt aus produktionstheoretischer Sicht darin, einen Weg zu finden, paraverbale Elemente der Mündlichkeit klar, verständlich und anschaulich schriftlich umzusetzen. So sind beispielsweise Ironiesignale in einer mündlichen Vortragssituation für den Rezipienten leicht zu erkennen. Sie ohne mündliche Beispiele nur im Text zu beschreiben, bereitet aber Schwierigkeiten. Um die oralen Phänomene textuell zu inszenieren, greifen die Autoren daher zu verschiedenen methodischen Vorgehensweisen, deren Funktionieren genauer untersucht werden soll. Bedeutsam sind dabei vor allem Metaphernbildungen aus anderen Sinnesbereichen (z.B. vox candida, „helle Stimme“; vox aspera, „raue Stimme“), die Übertragung von Begriffen aus dem Bereich der Schriftlichkeit auf die Mündlichkeit (z.B. Asianismus/Attizismus; die virtutes elocutionis als virtutes pronuntiandi bei Quintilian) und das Rekurrieren auf mündliche Erlebnissituationen, die der Autor mit dem Leser gemeinsam hat (z.B. den mündlichen Unterricht).
Dabei steht die Rhetorik nicht losgelöst von den anderen antiken Künsten. Eingebettet in enge Diskurszusammenhänge mit der Musik, Schauspielerei, Philosophie und Medizin lassen sich die Überschneidungen mit diesen Disziplinen unter der Perspektive der vox neu analysieren.
Ritterheiliger und heiliger Ritter. Das spannungsreiche Erzählen vom heiligen Georg in der höfischen und geistlichen Literatur des Mittelalters
Das Projekt will sich dem spannungsreichen Konkurrenzverhältnis zweier kultureller Idealbilder des Mittelalters widmen: ,Ritter' und ,Heiliger'. Die Integration von ,Rittertum' und ,Heiligkeit' bzw. ,militia' und ,sanctitas' stellt ein Grundproblem der mittelalterlichen Kultur dar, dessen sozialhistorische Dimension sich etwa in den Legitimationszwängen der Kreuzzüge manifestiert. Fassbar werden Kompatibilisierungsprobleme der Konzepte von ,Ritterlichkeit' und ,Heiligkeit' aber auch in den literarischen Selbstbeschreibungen der mittelalterlichen (Erzähl)Kultur. Als besonders prägnanter Fall einer Kombination dieser Konzepte steht das Erzählen vom Ritterheiligen Georg im Zentrum des Projekts, ist dieser doch als kämpfender Ritter wie auch als leidender Märtyrer adelige und klerikale Vorbildfigur.
In diesen Erzähltraditionen des Georgsstoffes - so die Grundthese des Vorhabens - produziert der Ritter- und Heiligenstatus des Protagonisten Paradoxien, die aus an sich völlig inkompatiblen Darstellungszwängen herrühren, die mit den beiden kulturellen Leitbildern verbunden sind: Von einem Ritter muss anders erzählt werden als von einem Heiligen.
Das Projekt will daher danach fragen, welche narrativen Strategien zur Bewältigung von Inkompatibilitäten zwischen widersprüchlichen anthropologischen Implikationen zur Anwendung kommen. Als Ausgangspunkt erscheint dabei die Beobachtung einer gewissen "diskurstraditionellen Dynamik" (W. Oesterreicher) des Georgssujets erfolgsversprechend, die sich im ,Wandern' eines Erzählgegenstands - der Georgsvita - durch verschiedene Diskurstraditionen widerspiegelt: Das mittelalterliche Erzählen vom heiligen Georg manifestiert sich in Legendarepisoden genauso wie in Reinbots von Durne höfischer Dichtung oder dem althochdeutschen Heldenpreislied über Gorio. Das Projekt setzt hier an, um zu untersuchen, mit welchen je unterschiedlichen Textualisierungsstrategien in teils sehr disparaten Textsorten und Kommunikationsräumen (Hof vs. Kloster!) ein normativ heterogener Erzählgegenstand homogenisiert wird. ,Textualität' als ,Vertextung eines gleichen Erzählgegenstands in unterschiedlichsten Produktions- und Rezeptionszusammenhängen' - hier knüpfen die geplanten Untersuchungen in ihrer Leithypothese systematisch eng an Grundsatzfragen des Internationalen Doktorandenkollegs ,Textualität in der Vormoderne' an.
Mit meinem Dissertationsprojekt verfolge ich das Ziel, einen Beitrag zur sprachhistorischen Erfassung des Königreichs Sizilien zu leisten. Durch einen nicht-teleologisch ausgerichteten Blick soll die mehrsprachige Textualität Siziliens im 16. und 17. Jahrhundert unter Berück-sichtigung der dynamischen Koexistenz verschiedener Idiome erforscht werden. Als exempla-rischer Untersuchungsgegenstand hierfür bietet sich die Schriftlichkeit der sogenannten libri di segreti an. Es handelt sich dabei um breitgefächerte Manuskripte sizilianischer Magier, die Rezepte, Instruktionen und Gebete enthielten und mit deren Hilfe sämtliche Krankheiten ge-heilt und Unglücksfälle ferngehalten werden sollten.
Die marginalisierte, aber alles andere als marginale Diskurstradition der magisch-therapeutischen Belehrungen scheint trotz Offensive der katholischen Kirche eine ungebrochene Kontinuität durch die zu untersuchenden Epochen aufzuweisen, wobei anzunehmen ist, dass textuell-diskursive und sprachliche Typik Hand in Hand gehen. So bezeugen einige Handschriften des 16. und 17. Jahrhunderts, die außerhalb der Institution der Kirche zirkulierten und somit nicht der post-tridentinischen Sprachpolitik unterlagen, die Beständigkeit der mundartigen Schreibtradition Siziliens. Über den Erhalt vernakulärer Sprachformen hinaus ist desweiteren eine Affinität zu Mehrsprachigkeit bzw. sprachlicher Hybridität vor allem in Bezug auf Zauber- und Heilungssprüche zu beobachten. Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass insbesondere diese an der Schnittstelle von Magie, Religion und (Para-)Medizin zu verortenden, der elaborierten Mündlichkeit entsprechenden Textualitätsformen als ein noch weitgehend unerforschter Forschungsgegenstand wertvolle Hinweise auf die mehrsprachige Wirklichkeit des kommunikativen Raums Sizilien liefern können.
Geltungskonkurrenzen – Vermittlung und Autorisierung von Wissen in deutschen pikaresken Texten des 17. Jahrhunderts
Am Beginn des 17. Jahrhunderts wird in Deutschland das Textmuster der novela picaresca adaptiert, das stofflich-motivisch kaum innovative Momente birgt, dem aber strukturell eine gewisse Brisanz gegenüber traditionellen Gattungen mitgegeben ist: ein Ich-Erzähler (ein Picaro oder eine Picara) entfaltet, dem Muster der Autobiographie entsprechend, aus retrospektiver Sicht sein Leben. In meiner Dissertation möchte ich in detaillierten Textanalysen zeigen, wie und mit welcher Intention die deutschen Autoren das Erzählmodell ihrer spanischen bzw. italienischen Vorgänger übernehmen und, damit zusammenhängend, auf welche Weise das Erzählmodell genutzt wurde, um Wissen zu vermitteln. Denn an den Adaptationen ist vor allem auffallend, dass die deutschen Übersetzer die relativ freie Bauform der pikaresken Texte, die Folge von relativ selbstständigen Episoden, in besonderer Weise funktionalisierten, um Wissensbestände unterschiedlichster Art einzubetten. In meinem Projekt sollen vier pikareske Texte einer vergleichenden Betrachtung unterzogen und auf diese Weise das Varianzspektrum der Wissensvermittlung, der Formen von Autorisierung und den daraus erwachsenden Geltungskonkurrenzen in pikaresken Texten dargestellt werden: die anonyme Übersetzung der Iustina Dietzin Picara genandt (1620 und 1626/27), Aegidius Albertinus: Der Landstörtzer Gusmann von Alfarche (1615), die unter dem Pseudonym Martin Frewdenhold veröffentlichte Fortsetzung des Gusman: Der Landstörtzer GVSMAN Von Alfarche, oder Picaro genant. Dritter Theil (1626) und der erste deutsche pikareske Originalroman Lauf der Welt Und Spiel des Glücks von Hieronymus Dürer (1668). Dabei ist die meiner Dissertation zugrunde liegende Leitfrage nach Wissen in Literatur von höchster Aktualität, wie sich an den derzeitigen Debatten in Fachzeitschriften ablesen lässt. Diesen Debatten zugrundeliegende Konzepte zum Thema Wissen und Literatur werden deshalb in meiner Dissertation kritisch-produktiv aufzugreifen und auf ihre Applizierbarkeit hin zu prüfen, möglicherweise auch im Hinblick auf Wissen in vormodernen Texten zu problematisieren und zu erweitern sein. Neben diesem theoretischen Erkenntnisnutzen könnte der Ansatz über Text und Wissen besonders geeignet sein, die historische Charakteristik und spezifische kulturelle Leistung gerade der pikarischen Texte präziser zu erfassen, als es die bisherige Forschung in ihrer Beschränkung auf literatur- und gattungsgeschichtliche Linien oder sozialhistorische Funktionsbestimmungen vermocht hat.
Der Wiener Codex Epistolaris des Conrad Celtis als Beispiel frühneuzeitlicher Textualität
Die in der Forschung üblicherweise als Codex Epistolaris des Conrad Celtis bezeichnete Handschrift der österreichischen Nationalbibliothek in Wien enthält Abschriften von 266 an Conrad Celtis (1459 -1508) gerichteten Briefen, die im Umkreis und unter der Leitung des frühneulateinischen Dichters selbst kompiliert und redigiert wurden. Bisher ist sie vor allem als Haupt-Quelle für den 1934 erschienenen, von Hans Rupprich nach strikt historiographisch-biographischen Gesichtspunkten edierten "Briefwechsel" bekannt geworden und hat auch sonst fast ausschließlich als Steinbruch für Einzelinformationen zu Leben, Umfeld und Werken des deutschen "Erzhumanisten" gedient. Dabei wurde der Codex fast zwangsläufig auf den Status eines Textzeugen für die einzelnen Schreiben reduziert; dass uns in der Handschrift der seltene Glücksfall eines Arbeitsmanuskriptes erhalten ist, an dem wir das Projekt einer humanistischen Briefsammlung in statu nascendi beobachten können, geriet kaum in den Blick.
Im Gegensatz dazu wird die geplante Edition (die den Text zum ersten Mal in seiner historischen Form zugänglich machen wird) diese Briefsammlung in ihrem Anspruch als - wenn auch nur im Entwurfstadium überliefertes - Kunstwerk ernst nehmen und sie in der Geschichte der neulateinischen Literatur, insbesondere der humanistischen Briefliteratur, verorten. Kompositionsprinzipien, Binnenstruktur, Bezüge zur realen Biographie des Dichters und zu der stilisierten des elegischen bzw. lyrischen oder epigrammatischen Ich - dem wir in Celtis´ poetischen Werken begegnen und das den Namen des Poeten trägt -, Mehrstimmigkeit, Mehrsprachigkeit, Hintergründe und Umfeld der Kompilation - einschließlich der in Einzeltexte, Briefgruppen und die Sammlung als Ganzes einfließenden literarischen Traditionen und Diskurse - sind nur einige der Aspekte, von denen die spezifische Textualität dieses Buches geprägt ist, das keinen Schriftverkehr im modernen Sinn dokumentieren will. Sie entfaltet sich einerseits aus den Einzeltexten und den Zusammenhängen, aus denen sie kommen und zu denen sie zusammengefügt sind; vor allem letztere scheinen in den Augen der Kompilatoren die Überlieferungswürdigkeit der Texte ausgemacht zu haben; die Originale wurden nicht aufgehoben. Andererseits wirken diese Aspekte seiner Textualität auch - und teilweise massiv - auf die Einzelbriefe zurück, indem diese innerhalb der Sammlung vielfach für Aussagen instrumentalisiert und ihnen angepasst werden, die ihren ursprünglichen Zwecken nicht entsprechen. Schon als Sammlung von Adressatenbriefen ist der Codex dabei ein in seiner Zeit und seinem Umfeld ungewöhnliches Projekt; sein Autor Celtis tritt in seinem epistolographischen Monument ja nicht selbst als Briefschreiber auf, sondern bedient sich ausschließlich der Stimmen anderer, von denen er sich als ihr Briefpartner darstellen lässt, ein eigenes Verfahren humanistischen self-fashionings (Greenblatt), das mit dem Codex Epistolaris vorläufig scheitert, jedoch im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts in den Händen anderer bekanntlich breite publizistische Wirkungen entfalten wird. Insofern und angesichts der über den Heidelberger Humanistenkreis nachweisbaren Kontakte muss das Briefprojekt daher als Keimzelle der Grundidee zu Publikationen wie den Illustrium Virorum Epistulae Reuchlins und letztlich auch den Epistulae Obscurorum Virorum gesehen werden, die eine neue Literaturgattung satirischen Schreibens begründen. Dabei verfolgt der Text sichtlich das Ziel eines gedruckten Monuments, ist aber dennoch nicht gleichzusetzen mit jenen Briefsammlungen, in denen anderere Humanisten sich mit eigenen Briefen ihre Denkmäler als Epistolographen setzen. Sein Material enthält viel Unfertiges, Lücken und Vorläufiges, so dass man an den unterschiedlichen Vollendungsstufen von Abschnitten der Handschrift und auch von einzelnen Briefen das Unternehmen einer humanistischen Briefsammlung als work in progress dokumentieren kann.
Wenn man diese Bedingungen der Textualitäten ignoriert oder sie mit solchen jüngerer Briefmodelle verwechselt, führt dies zwangsläufig zu Missverständnissen. Es gilt sie also zu rekonstruieren, zu untersuchen und zu beachten, will man den nahezu revolutionären Versuch einer mosaikartig aus mitunter sehr heterogenen Einzelaussagen montierten Vertextung der vormodernen Literatenexistenz des Poeten Conrad Celtis verstehen und seine Eigenart und seine Stellung innerhalb der Geschichte nicht nur der neulateinischen Briefliteratur zutreffend beurteilen. Wege zu einem solchen Verständnis wird eine auf den neu aus der Handschrift entzifferten Text bezogene Untersuchung weisen, die von detaillierten Analysen ausgewählter Einzelbriefe ausgehen, besonderes Gewicht aber auf Zusammenhänge, die innerhalb der Sammlung Briefgruppen generieren, auf in die Kompilation hineinwirkende Modelle und Einflüsse und ihre über sie selbst hinausweisenden Ansätze legen wird, um eine der historischen Eigenart der Einzeltexte und des Gesamttextes angemessene Würdigung zu ermöglichen.
* Ideelle Förderung.